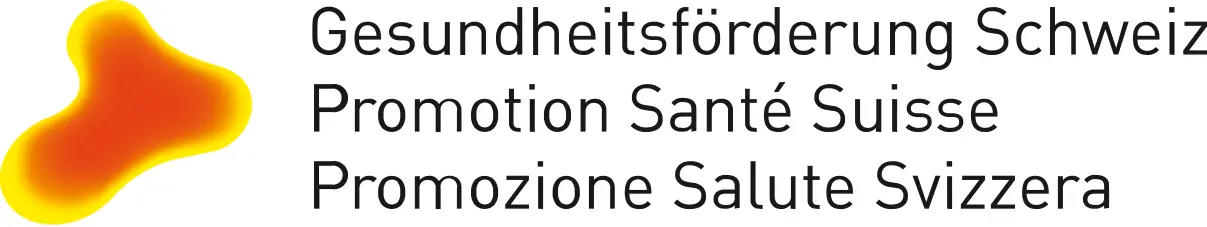Dossier: BMI-Monitoring bei Kindern und Jugendlichen in der Schweiz

Dieses Dossier bündelt zentrale Ergebnisse, Einordnungen und häufige Fragen – und gibt Hinweise für eine differenzierte und respektvolle Berichterstattung.
FAQ
Was ist das BMI-Monitoring?
Gesundheitsförderung Schweiz erhebt in zwei sich ergänzenden Studienformaten regelmässig Daten zum Körpergewicht von Schulkindern in der Schweiz.
Zum einen werden seit dem Schuljahr 2005/2006 jährlich die Gewichtsdaten von Kindern und Jugendlichen aus den schulärztlichen Reihenuntersuchungen in den Städten Basel, Bern und Zürich analysiert. Diese fortlaufende Auswertung erlaubt eine kontinuierliche Beobachtung der Entwicklung von Übergewicht und Adipositas auf städtischer Ebene.
Zum anderen führt Gesundheitsförderung Schweiz alle vier Jahre ein vergleichendes BMI-Monitoring durch. Dieses ergänzt die Daten der drei Städte mit Daten aus weiteren Kantonen und Städten, um ein möglichst breites Bild der Situation in der ganzen Schweiz zu erhalten. Die Erhebungen fanden bisher in den Jahren 2010, 2013, 2017, 2021 und 2025 statt.
Das Monitoring vergleicht die Schulstufen der Volksschule: Grundstufe (Zyklus 1), Mittelstufe (Zyklus 2) und Oberstufe (Zyklus 3). Ziel ist es, Veränderungen der Häufigkeit von Übergewicht und Adipositas im Zeitverlauf und zwischen Regionen zu erkennen – und daraus Hinweise für gezielte Prävention und Gesundheitsförderung abzuleiten.
Die wichtigsten Ergebnisse 2025 auf einen Blick
Die aktuelle Erhebung im Rahmen des «vergleichenden BMI-Monitorings» basiert auf Daten von über 30'000 Schüler*innen aus 11 Kantonen und vier Städten:
- Analyse von Daten aus den Kantonen Aargau, Basel-Stadt, Graubünden, Jura, Luzern, Obwalden, St. Gallen, Schwyz, Uri, Waadt und Zürich sowie den Städten Bern, Freiburg, Winterthur und Zürich
- Auf der Grundstufe ist ein deutlicher Rückgang des Anteils übergewichtiger Kinder zu verzeichnen – von 15,8 Prozent im Jahr 2010 auf 11,1 Prozent im Jahr 2025.
- Auf der Mittelstufe ging der Anteil zwischen 2010 (19,1%) und 2017 (16,5%) zunächst zurück, ist seither aber wieder auf 18,6 Prozent angestiegen.
- Auf der Oberstufe stagniert der Anteil seit 2010 (2010: 20,5%; 2025: 20,9%), zeigt aber erste Anzeichen einer Entspannung.
- Die Übergewichtsprävalenzen steigen nicht nur mit der Schulstufe, sondern variieren auch zwischen den Kantonen und Städten erheblich. Allerdings lässt sich im Gegensatz zu früheren Analysen kein klarer Stadt-Land-Unterschied mehr nachweisen.
- Auch der Geschlechterunterschied spielt kaum eine Rolle, während die soziale Herkunft und die Staatsangehörigkeit einen ausgeprägten Zusammenhang mit dem Körpergewicht zeigen. Vor allem in Hinblick auf den Einfluss der sozialen Herkunft fällt auf, dass sich dieser seit der Studie des Jahres 2021 noch einmal verstärkt hat.
- Allgemein lässt sich gegenüber dem ersten Bericht aus dem Jahr 2010 ein Rückgang der Gesamtprävalenz um 1,3 Prozentpunkte nachweisen. Angesichts knapper Mittel für die Prävention von Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen sowie international eher steigender Zahlen kann diese Entwicklung als Teilerfolg gewertet werden.
Warum macht Gesundheitsförderung Schweiz das Monitoring?
Das BMI-Monitoring dient dazu, die Entwicklung von Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen in der Schweiz systematisch zu erfassen – über die Zeit, nach Schulstufe, Region, Geschlecht und sozialem Hintergrund. Es schafft eine solide Datengrundlage, um Trends zu erkennen und Entwicklungen einzuordnen. Für Gesundheitsförderung Schweiz ist das Monitoring ein wichtiges Instrument zur Orientierung: Es ermöglicht Rückschlüsse darauf, bei welchen Zielgruppen ein erhöhter Handlungsbedarf besteht und wo Präventionsmassnahmen Wirkung zeigen. Auch soziale Unterschiede in der Verteilung von Übergewicht werden durch das Monitoring sichtbarer und weisen auf strukturellen Handlungsbedarf hin.
Das Monitoring unterstützt damit die strategische Ausrichtung gesundheitsfördernder Aktivitäten – insbesondere der kantonalen Aktionsprogramme (KAP) – und liefert wichtige Impulse für Fachpersonen, Politik und Gesellschaft. Es leistet auch einen Beitrag zur Umsetzung der nationalen NCD-Strategie und stärkt die Qualität und Wirkung langfristiger Gesundheitsförderung.
Kritische Einordnung: Was kann der BMI – und was nicht?
Der BMI ist ein einfacher Kennwert, der das Verhältnis von Körpergewicht zur Körpergrösse abbildet. Er wird international verwendet, um das Körpergewicht in Kategorien wie «normalgewichtig», «übergewichtig» oder «adipös» einzuordnen.
Der BMI mit seinen Klassifizierungsstufen steht als Indikator für den gewichtsbedingten Gesundheitswert immer wieder in der Kritik. Als Indikator für die gesundheitliche Situation einer Bevölkerung (Gesamtprävalenz) aber hat sich der BMI bewährt – etwa im Rahmen von Langzeitbeobachtungen wie dem BMI-Monitoring. Auf dieser sogenannten Populationsebene hilft er, Trends über Zeit und Unterschiede zwischen Regionen, Altersgruppen oder sozialen Lagen sichtbar zu machen.
Auf individueller Ebene hingegen ist der BMI nur bedingt aussagekräftig. Er berücksichtigt weder Körperzusammensetzung (Muskel- vs. Fettmasse) oder körperliche Entwicklung. Gerade bei Jugendlichen im Wachstum kann der BMI zu Fehlinterpretationen führen. Auch psychosoziale Aspekte wie das Körperbild, das Selbstwertgefühl oder Essverhalten bleiben dabei unberücksichtigt.
Gesundheitsförderung Schweiz setzt den BMI deshalb mit Bedacht ein – als Langzeitstudie, nicht als individuelles Diagnoseinstrument. Entscheidend ist: Gesundsein heisst mehr, als im «Normalbereich» des BMI zu liegen. Eine ganzheitliche Gesundheitsförderung bezieht auch psychische Gesundheit, Körperwahrnehmung und soziale Lebensbedingungen mit ein.
Was wirkt – und wo braucht es neue Ansätze?
Alle 26 Kantone setzen aktuell kantonale Aktionsprogramme (KAP) zur Förderung von Ernährung und Bewegung bei Kindern und Jugendlichen um. Diese Programme haben sich in den letzten Jahren als wirkungsvolles Instrument der Gesundheitsförderung etabliert und gelten als Erfolgsmodell.
Die positiven Entwicklungen bei den Jüngsten belegen dies: Der Anteil übergewichtiger Kinder ist nicht nur im Kindergarten, sondern auch in der Primarschule rückläufig. Es gibt klare Hinweise, dass die bisherigen Aktivitäten wirksam sind – insbesondere dort, wo gesunde Ernährung, Bewegung und ein förderliches Umfeld gemeinsam gestärkt werden.
Gleichzeitig bleibt der Handlungsbedarf hoch – besonders auf der Mittel- und Oberstufe. Hier stagnieren die Zahlen oder steigen wieder an. Es braucht neue Ansätze, die die Jugendlichen in ihrer Lebensrealität erreichen und sich verändernde Verhaltensgewohnheiten (z.B. zunehmende Social Media – Nutzung) berücksichtigen – mit mehr Beteiligung, Peer-Ansätzen und strukturellen Verbesserungen ihres Umfelds.
Warum sind Kinder aus sozioökonomisch benachteiligten Familien häufiger betroffen?
Das Risiko für Übergewicht hängt eng mit den Lebensbedingungen von Kindern und Familien zusammen. So sind Kinder von Eltern ohne nachobligatorische Ausbildung über dreimal so häufig übergewichtig wie jene von Eltern mit Tertiärabschluss. Auch bei Schüler*innen ohne Schweizer Pass liegt der Anteil mit 24 Prozent deutlich höher als bei ihren Schweizer Mitschüler*innen (14,2 %). In verschiedenen nationalen und internationalen Studien (z.B. Berli, Sempach & Herter-Aeberli, 2024; Eiholzer, Fritz & Stephan, 2021; Mech et al., 2016; Paalanen et al., 2022; Rakić et al., 2024) wird insbesondere die Bedeutung von sozialer Herkunft und sozioökonomischen Benachteiligungen oder Privilegierungen für das Übergewichtsrisiko immer wieder hervorgehoben.
Diese Unterschiede lassen sich nicht auf einzelne Merkmale wie Bildungsstand oder Herkunft reduzieren – sie spiegeln vielmehr komplexe Zusammenhänge wider und die Ursachen sind vielfältig: Finanzielle Engpässe, begrenzter Wohnraum, eingeschränkte Bewegungsmöglichkeiten im Quartier oder ein hoher Medienkonsum beeinflussen das Bewegungs- und Essverhalten negativ. Hinzu kommt, dass Eltern in belasteten Lebenslagen oft weniger Zugang zu gesundheitsförderlichem Wissen und Angeboten haben – und weniger Ressourcen, um diese umzusetzen.
Wie der Grundlagenbericht zur Chancengleichheit von Gesundheitsförderung Schweiz zeigt, sind soziale Unterschiede beim Gesundheitszustand kein individuelles Problem, sondern Ausdruck struktureller Ungleichheiten. Deshalb reichen gesundheitspolitische Massnahmen allein nicht aus. Eine wirksame Prävention muss auch auf bildungs-, sozial- und gesellschaftspolitischer Ebene ansetzen – und Rahmenbedingungen schaffen, die es allen Kindern ermöglichen, gesund aufzuwachsen. Gesundheitsförderung Schweiz setzt sich deshalb für eine chancengerechte Gesundheitsförderung ein, die alle Lebensphasen und Lebenslagen mitdenkt.
Was hat das Körperbild von Jugendlichen mit dem BMI zu tun?
Gesund sein ist mehr als einen «normalen» BMI-Wert zu haben. Für Kinder und Jugendliche spielt die Wahrnehmung des eigenen Körpers eine zentrale Rolle – nicht nur im Zusammenhang mit Gesundheit, sondern auch mit Identität, Selbstwert und Zugehörigkeit.
Wie Kinder und Jugendliche ihren Körper wahrnehmen, wird stark durch gesellschaftliche Schönheitsideale geprägt. In unserer Kultur gilt: schlank, sportlich, schön und leistungsfähig zu sein ist positiv – während Übergewicht oft mit Faulheit, fehlender Disziplin oder mangelndem Erfolg assoziiert wird. Diese Bilder wirken auf beide Geschlechter, aber in unterschiedlicher Form.
Mädchen orientieren sich häufig an einem schlanken und makellosen Ideal. Junge Männer hingegen verspüren öfter den Wunsch, muskulös zu wirken. Problematisch wird dies, wenn daraus exzessives Training oder der Griff zu leistungssteigernden Substanzen entsteht. Zwar betrifft das nicht alle, aber Fachpersonen beobachten zunehmend Fälle, in denen der Wunsch nach einem „perfekten“ Körper zu gesundheitsschädlichem Verhalten führt.
Ein weiterer Einflussfaktor ist die Nutzung sozialer Medien: Jugendliche sehen sich dort täglich mit idealisierten Körperbildern konfrontiert – oft ohne zu wissen, dass viele Fotos stark bearbeitet sind. Deshalb ist die Förderung der Medienkompetenz zentral: Jugendliche sollten kritisch reflektieren können, wie Bilder entstehen und welche unrealistischen Erwartungen sie erzeugen.
Auch das gesellschaftliche Bild von übergewichtigen Menschen hat sich kaum positiv verändert: In der Regel werden sie nach wie vor selten mit Selbstbewusstsein, Erfolg oder Attraktivität in Verbindung gebracht. Umso wichtiger ist es, ein breiteres Verständnis von Gesundheit zu fördern – jenseits von Gewichtszahlen und Schönheitsnormen.
Gesundheitsförderung Schweiz unterstützt daher Projekte zur Stärkung eines positiven Körperbilds und setzt sich für eine Kultur ein, in der Vielfalt, Selbstakzeptanz und psychische Gesundheit gleichermassen zählen. Die Plattform healthybodyimage.ch bietet konkrete Informationen und Materialien für Jugendliche, Eltern und Fachpersonen.
Was tut und tat Gesundheitsförderung Schweiz, um den BMI zu beeinflussen?
Gesundheitsförderung Schweiz setzt sich dafür ein, Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine ausgewogene Ernährung und regelmässige Bewegung im Alltag von Kindern und Jugendlichen ermöglichen. Denn beides trägt nachweislich dazu bei, ein gesundes Körpergewicht zu fördern – und damit auch die langfristige Entwicklung des BMI in der Bevölkerung positiv zu beeinflussen.
Ein zentrales Instrument dabei sind die kantonalen Aktionsprogramme (KAP), die aktuell in allen 26 Kantonen umgesetzt werden. Diese Programme unterstützen unter anderem Schulen, Kindertagesstätten, Gemeinden oder Quartiere dabei, gesundheitsförderliche Lebensbedingungen zu gestalten – zum Beispiel mit bewegungsfreundlichen Aussenräumen, gesundem Schulessen oder familienorientierten Angeboten.
Konkrete Umsetzungsbeispiele sind etwa:
- das Projekt «Purzelbaum», das Bewegung und ausgewogene Ernährung früh in den Alltag von Kindertagesstätten und Schulen integriert. Die Fachpersonen werden dabei gezielt geschult und die Räume entsprechend gestaltet – so dass mehr Bewegung im Alltag möglich wird.
- das Angebot «Femmes-Tische / Männer-Tische», das sich auch an Eltern richtet – insbesondere aus sozial benachteiligten Gruppen. In moderierten Gesprächsrunden werden auf Augenhöhe Wissen, Erfahrungen und alltagspraktische Tipps zu Gesundheit, Ernährung, Bewegung und Erziehung ausgetauscht.
Auch die Unterstützung von Projekten zur Stärkung des positiven Körperbildes – wie über die Plattform healthybodyimage.ch oder PEP - gemeinsam essen – gehört dazu. Denn wer ein gesundes Verhältnis zum eigenen Körper entwickelt, trifft eher Entscheidungen, die das körperliche und psychische Wohlbefinden stärken.
Wichtig dabei: Gesundheitsförderung Schweiz sieht es nicht als Ziel, den BMI einzelner Personen zu beeinflussen. Vielmehr geht es darum, verhältnismässige und nachhaltige Strukturen zu schaffen, die Kindern und Jugendlichen unabhängig von Herkunft und Lebenssituation gesunde Entwicklungschancen ermöglichen.
Gib es neben dem BMI-Monitoring weitere Studien zum Thema?
In der Schweiz hat Herter-Aeberli (2024) im Auftrag des BAG den BMI bei 6- bis 12-jährigen Kindern erhoben. Für den internationalen Vergleich wird auf eine Übersichtsarbeit der WHO (2024) verwiesen, in der Daten zum Körpergewicht aus 40 europäischen Ländern bei 7- bis 9-Jährigen ausgewertet wurden.
Empfehlung für eine respektvolle Bildauswahl
Eine verantwortungsvolle Berichterstattung über das Thema Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen umfasst nicht nur sachliche Informationen, sondern auch eine achtsame Bildsprache. Bilder prägen die Wahrnehmung – insbesondere bei sensiblen Themen wie Körpergewicht, Körperbild und Gesundheit. Gerade Bilder, die mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt wurden, erfordern besondere Sorgfalt.
Gesundheitsförderung Schweiz empfiehlt Medienschaffenden daher:
- Keine stigmatisierenden Darstellungen: Zeigen Sie Kinder und Jugendliche nicht isoliert, von hinten oder in problematischem Kontext (z. B. mit betontem Fokus auf Körperstellen, unvorteilhaften Perspektiven oder in Verbindung mit ungesunden Lebensmitteln).
- Vielfalt zeigen: Verwenden Sie Bilder, die Diversität sichtbar machen – in Bezug auf Körperformen, Herkunft, Alter, Geschlecht und Fähigkeiten.
- Wohlbefinden statt Defizit: Setzen Sie auf positive Bildwelten, die Freude an Ernährung und Bewegung, gesunde Alltagsmomente oder soziale Teilhabe zeigen – ohne moralisierende Botschaften.
- Kein normierendes Schönheitsideal: Vermeiden Sie idealisierte, retuschierte oder überinszenierte Darstellungen. Zeigen Sie, wenn möglich, echte Menschen in echten Situationen.
- KI-Bilder neigen dazu, gängige Körper- und Schönheitsnormen zu reproduzieren. Prüfen Sie sorgfältig, ob Diversität, Natürlichkeit und Inklusion gewahrt sind.