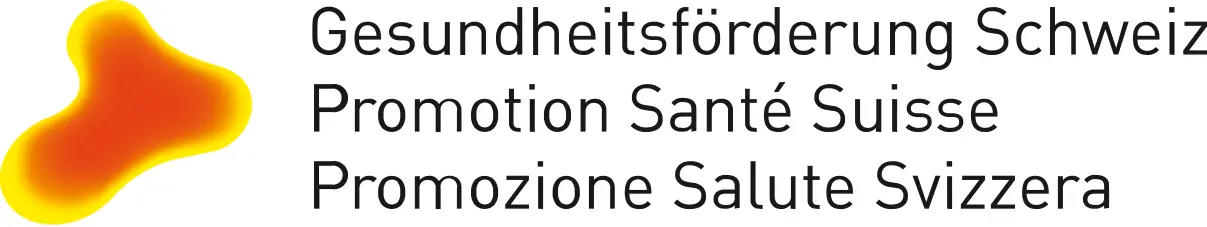BMI-Monitoring 2025: Rückgang des Übergewichts bei Kindern und Jugendlichen, aber deutliche Unterschiede nach Schulstufe

Unterschiedliche Entwicklungen nach Schulstufe
Die aktuelle Erhebung basiert auf Daten von über 30'000 Schüler*innen aus elf Kantonen und vier Städten. Auf der Grundstufe ist ein deutlicher Rückgang des Anteils übergewichtiger Kinder zu verzeichnen – von 15,8 Prozent im Jahr 2010 auf 11,1 Prozent im Jahr 2025. Auf der Mittelstufe ging der Anteil zwischen 2010 (19,1%) und 2017 (16,5%) zunächst zurück, ist seither aber wieder auf 18,6 Prozent angestiegen. Auf der Oberstufe stagniert der Anteil seit 2010 (20,5%; 2025: 20,9%), zeigt aber erste Anzeichen einer Entspannung. Der Anteil an stark übergewichtigen (adipösen) Kindern ist in den genannten Werten enthalten.
Leichter Rückgang seit 2010 – ein Teilerfolg
Gegenüber dem ersten Bericht aus dem Jahr 2010 lässt sich ein Rückgang der Gesamtprävalenz um 1,3 Prozentpunkte nachweisen. Angesichts knapper Mittel für die Prävention von Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen sowie international steigender Zahlen kann diese Entwicklung als Teilerfolg gewertet werden.
Grosse Unterschiede zwischen Regionen – Stadt und Land nähern sich an
Die Ergebnisse zeigen deutliche regionale Unterschiede: Auf der Grundstufe variiert der Anteil übergewichtiger Kinder je nach Kanton um rund sechs Prozentpunkte, auf der Oberstufe sogar um mehr als acht Prozentpunkte. Während frühere Auswertungen klare Unterschiede zwischen Stadt und Land zeigten, sind diese Differenzen heute kaum noch nachweisbar – wohl in der Folge der Ausdehnung und des Zusammenwachsens der Agglomerationen.
Soziale Herkunft und Lebenskontext beeinflussen das Risiko deutlich
Die Analyse der vorhandenen Daten zeigt: Das Risiko für Übergewicht hängt eng mit den Lebensbedingungen von Kindern und Familien zusammen. So sind Kinder von Eltern ohne nachobligatorische Ausbildung über dreimal so häufig übergewichtig wie jene von Eltern mit Tertiärabschluss. Auch bei Schüler*innen ohne Schweizer Pass liegt der Anteil mit 24 Prozent deutlich höher als bei ihren Schweizer Mitschüler*innen (14,2 %).
Diese Unterschiede lassen sich nicht auf einzelne Merkmale wie Bildungsstand oder Herkunft reduzieren – sie spiegeln vielmehr komplexe Zusammenhänge wider: etwa die Gesundheitskompetenz im Elternhaus, das alltägliche Ernährungs- und Bewegungsverhalten oder den Zugang zu unterstützenden Angeboten.
«Diese Zahlen machen deutlich: Übergewicht hat gesellschaftliche Ursachen und verlangt gesellschaftliche Lösungen. », sagt Thomas Mattig, Direktor von Gesundheitsförderung Schweiz. «Damit Prävention wirkt, muss sie dort ansetzen, wo Kinder leben – und sich an ihren Lebenswelten orientieren.»
Gezielte Prävention sowie Stärkung der Chancengerechtigkeit bleiben zentral
Die Ergebnisse machen deutlich: Es braucht weiterhin gezielte Massnahmen, besonders für Kinder aus sozial benachteiligten Verhältnissen. Dabei ist nicht das Fehlen von Angeboten das Hauptproblem, sondern deren Reichweite. Mögliche bestehende Zugangsbarrieren gilt es systematisch zu identifizieren und gezielt abzubauen. Wichtig ist auch, dass die Erfolge auf der Grundstufe auf die höheren Schulstufen übertragen werden. Frühzeitige Gesundheitsförderung und Prävention sind dafür entscheidend. Gesundheitsförderung Schweiz setzt auf Massnahmen, die Schulen, Gemeinden und Kantone vernetzen. Weil viele Risiken strukturell bedingt sind, braucht es neben der Gesundheitspolitik auch Unterstützung aus der Bildungs- und Sozialpolitik. Nur so können gleiche Chancen auf Gesundheit ermöglicht werden.
Zahlreiche Umsetzungsbeispiele von bewährten Massnahmen für Kinder und Jugendliche finden sich in der Orientierungsliste von Gesundheitsförderung Schweiz. Weitere Informationen zur Förderung von Chancengerechtigkeit sind online auf der Themenseite zu Chancengleichheit abrufbar. Passend dazu hat zudem die Fachhochschule Nordwestschweiz mit Unterstützung des Bundesamts für Gesundheit und Gesundheitsförderung Schweiz eine Videoclip-Reihe zu Erfolgskriterien chancengerechter Gesundheitsförderung und Prävention entwickelt.
Weitere Informationen
Für weitere Auskünfte oder Fragen steht Ihnen die Medienstelle von Gesundheitsförderung Schweiz per E-Mail medien@gesundheitsfoerderung.ch zur Verfügung.
Alle Grafiken in einer Zip-Datei
Über das BMI-Monitoring
Mehr zum Thema
Gesundheitsförderung Schweiz
Gesundheitsförderung Schweiz ist eine Stiftung, die von Kantonen und Versicherern getragen wird. Mit gesetzlichem Auftrag initiiert, koordiniert und evaluiert sie Massnahmen zur Förderung der Gesundheit und zur Verhütung von Krankheiten (Krankenversicherungsgesetz, Art. 19). Die Stiftung unterliegt der Kontrolle des Bundes. Oberstes Entscheidungsorgan ist der Stiftungsrat. Die Geschäftsstelle besteht aus Büros in Bern und Lausanne. Jede Person in der Schweiz leistet einen monatlichen Beitrag von 40 Rappen zugunsten von Gesundheitsförderung Schweiz, der von den Krankenversicherern eingezogen wird.