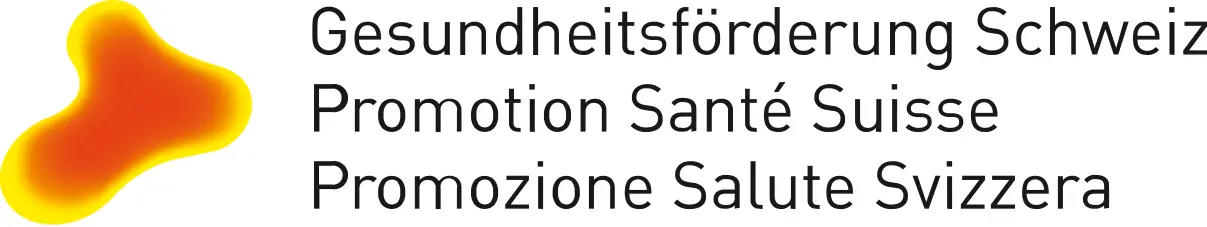Wirkungen im Bereich Prävention in der Gesundheitsversorgung

Präventive Massnahmen mindern Leid von Patient*innen
Zahlreiche Erfahrungsberichte zeigen, dass ein gesunder Lebensstil und die Kenntnisse einer Krankheit einen positiven Effekt auf die Last dieser Krankheit haben können. Diverse Studien mit Osteoarthritis-Patientinnen und -Patienten konnten z.B. aufzeigen, dass durch gezielte körperliche Aktivität Schmerzen signifikant gelindert und die körperliche Funktionsfähigkeit verbessert werden kann. Zudem konnte in einigen Studien Evidenz für eine verbesserte gesundheitsbezogene Lebensqualität im Bereich der sozialen Funktionsfähigkeit gezeigt werden (Hurley et al. 2018).
Selbstmanagement-Interventionen bei Patientinnen und Patienten mit chronisch obstruktiven Lungenkrankheiten (COPD), die zum Ziel haben, den Betroffenen Fähigkeiten zu vermitteln, um ihre Krankheit kontrollieren zu können, erzielten in verschiedenen Studien rund um den Globus eine verbesserte gesundheitsbezogene Lebensqualität bei den Betroffenen. Und sie führten zu einer Verringerung von Hospitalisationen (Anzahl und Dauer) und Aufnahmen in Notfallstationen aufgrund akuter Exazerbationen (Gadouri et al. 2005, Zwerink et al. 2014, Bourbeau 2015).
Präventive Massnahmen reduzieren Gesundheitskosten
Bei oben aufgeführten Interventionen bzw. Massnahmen konnte zudem gezeigt werden, dass Gesundheitskosten reduziert werden können. So wurde eruiert, dass rund 72 % der Trainingsinterventionen bei muskuloskelettalen und rheumatischen Erkrankungen kosteneffektiv sind (Guillon 2018). Zudem haben Kostenanalysen von Selbstmanagement-Interventionen mit COPD-Patientinnen und -Patienten verglichen zum üblichen Patientenmanagement im Spitalsetting Hinweise geliefert, dass dank Selbstmanagement-Interventionen zwischen 500 $ (Dewan et al. 2011) und 2000 $ (Bourbeau 2006) pro COPD-Patient_in eingespart werden kann.
Prävention in der Gesundheitsversorgung durch gezielte Projektförderung
Die unterstützten Projekte der PGV intervenieren in sechs prioritären Interventionsbereichen mit identifiziertem hohem Handlungsbedarf.
Prioritäre Interventionsbereiche I (Hauptbereiche)
Die drei zentralen Hauptbereiche (prioritäre Interventionsbereiche I) intervenieren vorwiegend auf der strukturellen Ebene und verlangen ein synergetisches Zusammenarbeiten der unterschiedlichen Systeme (Gesundheits-, Sozial- und Gemeinwesen) und der Akteure innerhalb der Systeme und über die Systemgrenzen hinweg. Die drei Hauptbereiche repräsentieren den Kern der Tätigkeiten der PGV. Sie müssen in allen eingereichten Projekten der PGV repräsentiert sein.
Die drei Hauptbereiche sind:
- Schnittstellen zwischen den Patient*innen, ihrem Lebensumfeld und den verschiedenen sie umgebenden Systemen (Gesundheits-, Sozial- und Gemeinwesen) sowie Schnittstellen zwischen den Systemen und den darin tätigen Akteuren der PGV
- Entwicklung und Implementierung von Gesundheitspfaden für Patient*innen mittels Kollaboration, Interprofessionalität und Multiprofessionalität der Multiplikator*innen
- Selbstmanagement-Förderung für gestärkte Selbstmanagement-Kompetenzen, Ressourcen und Selbstwirksamkeit für Patient*innen und deren Angehörige
Prioritäre Interventionsbereiche II (Querschnittsbereiche)
Die drei Querschnittsbereiche (prioritäre Interventionsbereiche II) intervenieren über die zentralen Handlungsbereiche der PGV hinweg. Sie setzen auf der operativen Ebene an und wirken direkt auf die unterschiedlichen Systeme und Akteure des Gesundheits-, Sozial- und Gemeinwesens. In jedem Projekt der PGV muss zusätzlich zu den drei Hauptbereichen mindestens ein Querschnittsbereich enthalten sein.
Die drei Querschnittsbereiche sind:
- Aus-, Weiter- und Fortbildung der Fachpersonen im Gesundheits-, Sozial- und Gemeinwesen
- Neue Technologien, insbesondere im Bereich Daten/Outcomes, eHealth und mHealth
- Wirtschaftlichkeit der Massnahmen, beispielsweise via Kosten-Nutzen-Analysen
Referenzen
- Bourbeau J, Collet JP, Schwartzman K, Ducruet T, Nault D, Bradley C. Economic benefits of self-management education in COPD. Chest. 2006; 130:1704-11.
- Bourbeau J, Granados D, Roze S, Durand-Zaleski I, Casan P, Köhler D, Tognella S, Viejo JL, Dal Negro RW, Kessler R. Cost-effectiveness of the COPD Patient Management European Trial home-based disease management program. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2019; 14:645-657.
- Dewan NA, Rice KL, Caldwell M, Hilleman DE. Economic evaluation of a disease management program for chronic obstructive pulmonary disease. COPD. 2011; 8:153-9.
- Gadoury MA, Schwartzman K, Rouleau M, Maltais F, Julien M, Beaupré A, Renzi P, Bégin R, Nault D, Bourbeau J. Self-management reduces both short-and long-term hospitalization in COPD. Eur Respir J 2005; 26:853-857.
- Guillon M, Rochaix L, Dupont JK. Cost-effectiveness of interventions based on physical activity in the treatment of chronic conditions: A systematic literature review. Int J Technol Assess Health Care. 2018; 34:481-497.
- Hurley M, Dickson K, Hallett R, Grant R, Hauari H, Walsh N, Stansfield C, Oliver S. Exercise interventions and patient beliefs for people with hip, knee or hip and knee osteoarthritis: a mixed methods review. Cochrane Database Syst Rev. 2018; CD010842.
- Zwerink M, Brusse-Keizer M, van der Valk PD, Zielhuis GA, Monninkhof EM, van der Palen J, Frith PA, Effing T. Self management for patients with chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2014; CD002990.
- Wieser S, Riguzzi M, Pletscher M, Huber CA, Telser H, Schwenkglenks M. How much does the treatment of each major disease cost? A decomposition of Swiss National Health Accounts. Eur J Health Econ. 2018; 19:1149-1161.
Kontakt
Beatrice Annaheim
Projektleiterin Wirkungsmanagement
Giovanna Raso
Projektleiterin Wirkungsmanagement