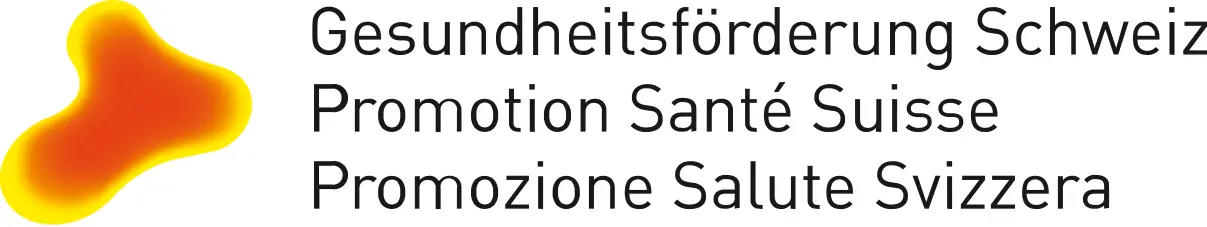Dossier: Stress
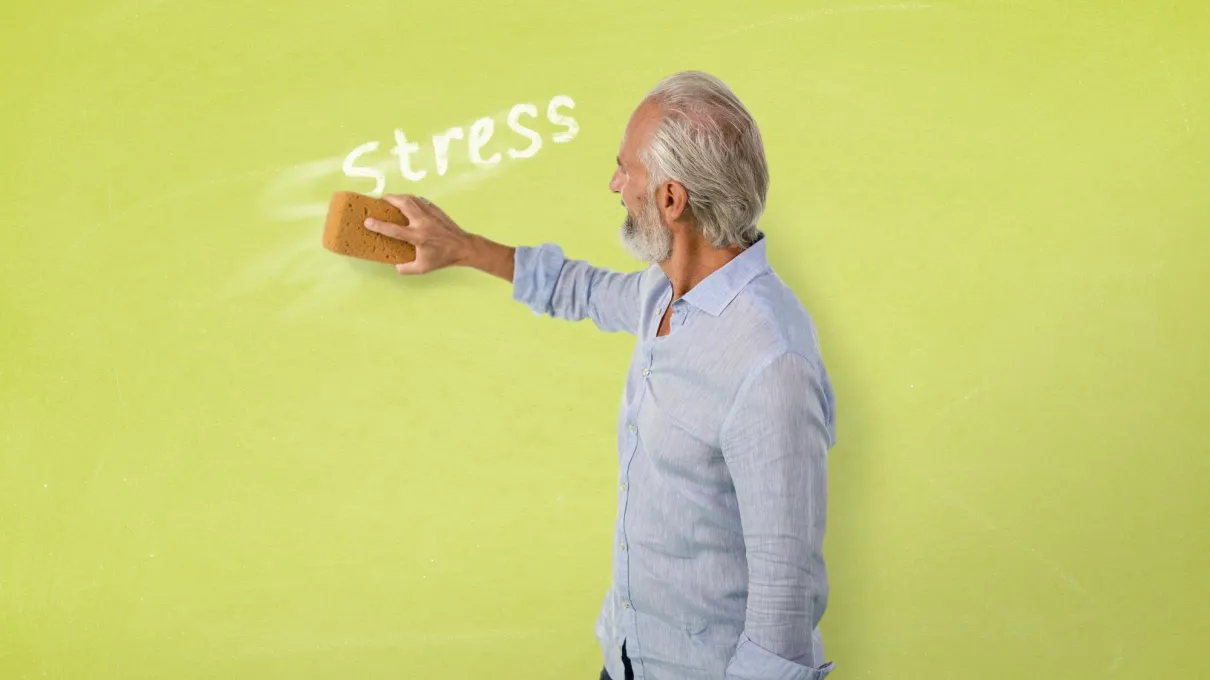
Stress am Arbeitsplatz ist eine der bedeutenden Herausforderungen der Arbeitswelt, die mit Folgen für die betroffenen Arbeitnehmenden (z.B. gesundheitliche Einschränkungen), aber auch für die Unternehmen (z.B. durch Fehlzeiten) einhergeht. Stress bezeichnet allgemein ein Ungleichgewicht zwischen Belastungen, mit denen eine Person konfrontiert wird, und den verfügbaren Bewältigungsmöglichkeiten (Ressourcen). Um die Entwicklungen der psychischen Gesundheit der Erwerbstätigen in der Schweiz zu beobachten und Unternehmen sowie Wirtschaftsakteur*innen darüber zu informieren, ermittelt Gesundheitsförderung Schweiz zusammen mit der Universität Bern und der ZHAW seit 2014 regelmässig Kennzahlen zum Ausmass von arbeitsbezogenem Stress und dessen Zusammenhang mit Gesundheit und Produktivität von Erwerbstätigen in der Schweiz. Der Job-Stress-Index gilt als «Stress-Mittelwert» der Schweiz.
Dieses Dossier bietet eine Übersicht über aktuelle Studien, relevante Daten und wissenschaftliche Erkenntnisse zum Thema arbeitsbedingter Stress in der Schweiz. Es liefert Einordnungen, Trends und Hintergrundinformationen, die für die Berichterstattung und Recherchen wichtig sind.
FAQ
Was ist Stress?
Der Begriff Stress wird umgangssprachlich häufig mit den Begriffen Belastung oder Beanspruchung gleichgesetzt. In der deutschsprachigen Arbeitswissenschaft werden diese Begriffe hingegen klar unterschieden. Psychische Belastung ist als Gesamtheit aller erfassbaren Einflüsse definiert, die von aussen auf den Menschen zukommen und psychisch auf ihn einwirken. Psychische Beanspruchung ist die unmittelbare Auswirkung psychischer Belastung auf das Individuum und somit ein innerer Zustand als Reaktion einer Person auf die psychische Belastung. Stress ist wiederum eine spezifische Form von Beanspruchung, nämlich ein Ungleichgewicht zwischen den Anforderungen der (Arbeits-)Umwelt und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten bzw. ein Ungleichgewicht zwischen den Angeboten der Umwelt (z.B. im Hinblick auf das Arbeitsklima) und den individuellen Bedürfnissen. Ein solches Ungleichgewicht erzeugt negative Emotionen, und so kann Stress als subjektiv unangenehmer Spannungszustand definiert werden.
Was sagen die neusten Stress-Zahlen?
Die Resultate der neusten Job-Stress-Index-Erhebung 2022 zeigen:
- Der Job-Stress-Index, der das durchschnittliche Verhältnis von arbeitsbezogenen Belastungen und Ressourcen der Erwerbstätigen in der Schweiz abbildet, lag 2022 mit 50.66 in einem Bereich, der ein im Mittel ausgeglichenes Verhältnis von Ressourcen und Belastungen anzeigt. Die leichte Verbesserung gegenüber 2020 (50.83) ist nicht signifikant, jedoch ist der Index weiterhin signifikant ungünstiger als 2014 und 2016. Durch die Covid19-Pandemie haben sich die Arbeitsbedingungen zum Teil verändert, dies hat jedoch nicht zu grösseren Veränderungen im Job-Stress-Index geführt. Es haben jedoch neue Belastungen und Ressourcen an Relevanz gewonnen. Die Sorge, dass man selbst oder jemand aus dem engsten Umfeld ernsthaft an Covid19 erkranken könnte, erwies sich als zusätzliche Belastung wie auch die empfundene soziale Isolation und die erhöhte arbeitsbezogene Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien. Diese Faktoren zeigen über den Job-Stress-Index hinaus einen Zusammenhang mit der Gesundheit.
- Der Anteil der Erwerbstätigen, deren Job-Stress-Index sich im kritischen Bereich befindet, beträgt 28.2 %. Diese Erwerbstätigen berichten über deutlich mehr Belastungen als Ressourcen. Der Anteil sinkt im Vergleich zu 2020 (29.6 %) leicht, jedoch nicht signifikant.
- Der Anteil der Erwerbstätigen, die sich emotional erschöpft fühlen, übersteigt mit 30.3 % erstmals seit 2014 die 30 %-Marke.
- Arbeitsbezogener Stress kostet die Wirtschaft rund 6.5 Mrd. CHF. Das ökonomische Potenzial, das sich durch die Reduktion von arbeitsbezogenem Stress ergeben kann, liegt somit 2022 niedriger als im Jahr 2020 (7.6 Mrd. CHF), der Unterschied ist jedoch nicht signifikant.
Welche Kennzahlen zu den Auswirkungen von arbeitsbedingtem Stress auf Gesundheit und Produktivität von Erwerbstätigen werden erhoben?
Gesundheitsförderung Schweiz ermittelt seit 2014 periodisch Kennzahlen zu den Auswirkungen von arbeitsbedingtem Stress auf Gesundheit und Produktivität von Erwerbstätigen. Der Job-Stress-Index gilt als «Stress-Mittelwert» der Schweiz. Er zeigt das Verhältnis von arbeitsbezogenen Belastungen und Bewältigungsmöglichkeiten (Ressourcen), die Erschöpfungsrate und bildet ausserdem das ökonomische Potenzial ab, dass von Verbesserungen durch systematisches betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) ausgeht.
Im Projekt SWiNG ermittelte Gesundheitsförderung Schweiz zudem, inwiefern sich Stressprävention und Gesundheitsförderung im Betrieb lohnen. Dies einerseits für die Mitarbeitenden und andererseits für die Betriebe selbst. Die Studie evaluiert die Wirkung und den Nutzen betrieblicher Gesundheitsförderung. Die Evaluation zeigt, dass die von den acht SWiNG-Pilotbetrieben umgesetzten Massnahmen der Stressprävention eine Wirkung auf die Gesundheit und auf die Arbeitsleistung von durchschnittlich 25 % aller Mitarbeitenden erzielen. Die Investitionen zahlen sich spätestens fünf Jahren nach Projektbeginn auch ökonomisch aus.
Wie oft wird der Job-Stress-Index erhoben?
Die entsprechende Datenerhebung findet alle zwei Jahre im Februar statt. Um sich den Veränderungen in der Arbeitswelt anzupassen, hat Gesundheitsförderung Schweiz jedoch beschlossen, den Job-Stress-Index anlässlich seines 10-jährigen Bestehens zu überarbeiten. Der Index und die Erhebungsmethode werden optimiert und auf den neuesten Stand gebracht. Die nächste Erhebung des Job-Stress-Index ist für 2026 geplant.
Gib es neben dem Job-Stress-Index weitere Studien?
Ja, beispielsweise der Barometer Gute Arbeit. Dieser ist ein Kooperationsprojekt der Berner Fachhochschule und Travail.Suisse, dem unabhängigen Dachverband der Arbeitnehmenden. Die repräsentativen Ergebnisse werden jährlich präsentiert und beleuchten die Qualität der Arbeitsbedingungen in der Schweiz und ihre Veränderungen.
Zudem misst der Schweizer Human-Relations-Barometer (ein Kooperationsprojekt der Universitäten Luzern und Zürich und der ETH Zürich) regelmässig die Einstellungen, Wahrnehmungen, Stimmungen und Absichten von Beschäftigten in der Schweiz.
Im Auftrag des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes hat zudem Sotomo die Haltung der Arbeitnehmenden in der Schweiz zur Flexibilität in der Arbeitswelt untersucht.
Wie hoch sind die geschätzten volkswirtschaftlichen Kosten von arbeitsbedingtem Stress in der Schweiz?
Stress kann dazu führen, dass die Produktivität von Erwerbstätigen reduziert ist, entweder durch Abwesenheit aufgrund von Krankheit (Absentismus) oder durch Anwesenheit trotz eingeschränkter Leistungsfähigkeit (Präsentismus). Dies verursacht Produktivitätsverluste von durchschnittlich 14,9 % der Arbeitszeit.
Würde man, beispielsweise mithilfe von Massnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM), für alle Erwerbstätigen in der Schweiz ein zumindest ausgeglichenes Verhältnis von Belastungen und Ressourcen erreichen, könnte die Schweizer Wirtschaft das ökonomische Potenzial von rund 6.5 Mrd. CHF (2020: 7.6 Mrd. CHF) ausschöpfen. 1.5 Mrd. CHF könnten durch die Reduktion von Absentismus und 5 Mrd. CHF durch die Reduktion von Präsentismus wieder zur Produktivität beitragen.
Was sind die Empfehlungen von Gesundheitsförderung Schweiz gegen Stress?
Es ist wichtig, Belastungen am Arbeitsplatz wo immer möglich zu minimieren und Ressourcen zu fördern. Um Stresssituationen besser bewältigen zu können, braucht es aber zuerst eine Analyse der Belastungsfaktoren und der persönlichen Ressourcen, beispielsweise mit der Job-Stress-Analysis. Damit können geplante und zielgerichtete Massnahmen abgeleitet und umgesetzt werden. Im Anschluss hilft ein systematisches betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM), die Gesundheit der Mitarbeitenden zu schützen und zu stärken. BGM ist die systematische Optimierung relevanter Faktoren für die Gesundheit im Betrieb. BGM schafft mittels Anpassung von Strukturen und Prozessen im Unternehmen günstige Bedingungen für die Gesundheit der Mitarbeitenden und trägt so zum Erfolg des Unternehmens bei. BGM erfordert zudem die Beteiligung aller Personengruppen im Unternehmen, ist in dessen Management integriert und kommt in seiner Kultur zum Ausdruck.
Mit dem Label «Friendly Work Space» und den BGM-Services unterstützt Gesundheitsförderung Schweiz Organisationen und Betriebe beim Aufbau eines systematischen BGM. Die Angebote wurden mit Fachleuten aus Wirtschaft und Wissenschaft entwickelt und optimiert. Das ganze Angebot ist hier zu finden.
Wie wirksam ist Stressprävention in Unternehmen?
Vorbeugen ist sinnvoller und günstiger, als die Kosten von Krankheit, Unfall, Fluktuation und Leistungseinschränkungen zu tragen. Die Ressourcen der Mitarbeitenden zu stärken, lohnt sich gleich doppelt:
- Ein verbessertes Verhältnis zwischen Belastungen und Ressourcen hat einen positiven Effekt auf die Gesundheit (emotionale Erschöpfung) der Arbeitnehmenden und bereits kleine Veränderungen wirken sich positiv auf die Gesundheit aus.
- Eine Investition in bessere Arbeitsbedingungen mittels der Reduktion der Belastungsfaktoren und Stärkung der Ressourcen lohnt sich direkt auch für die Wirtschaft und verringert die Produktivitätsverluste.
Ein günstiges Verhältnis von Belastungen und Ressourcen macht sich für Unternehmen jederzeit bezahlt: Es ist ein Schutzfaktor für die Gesundheit der Mitarbeitenden, der auch oder gerade in aussergewöhnlichen Belastungs- und Krisensituationen zum Tragen kommt. Somit trägt es dazu bei, die Leistungsfähigkeit des Unternehmens zu erhalten und diese Herausforderungen mit gesunden Mitarbeitenden zu bewältigen.
Im ausführlichen Wirkungsmodell BGM von Gesundheitsförderung Schweiz finden Sie eine grosse Auswahl an gesundheitsrelevanten Indikatoren und Kennzahlen.
Wie kann frühzeitig erkannt werden, dass Mitarbeitende unter zu starkem Stress leiden?
Ein erster Schritt dafür ist die Analyse der Belastungen und Ressourcen bei den Mitarbeitenden, beispielsweise mittels Befragungen wie der Job-Stress-Analysis. Die Erhebung typischer Belastungen, Ressourcen und des Gesundheitszustands kann so am effizientesten durchgeführt und interpretiert werden. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit der anonymen Teilnahme. Eine Organisation kennt nach der Befragung die konkreten Risiken und die Potenziale. Zudem kann sie gesundheitsfördernde Massnahmen zielgerichtet und wirkungsvoll umsetzen. Dank wiederholter Befragungen erhalten Organisationen ein Frühwarnsystem.
Wie wirken sich neue Arbeitsformen wie Homeoffice oder hybrides Arbeiten auf den Stress aus?
Das Arbeiten im Homeoffice hat seit 2020 stark zugenommen (siehe Längsschnittstudie Job-Stress-Index 2020–2022): Vor der Covid-19-Pandemie gaben 23 % der Befragten an, einen oder mehr Tage pro Woche im Homeoffice zu arbeiten; 2021 waren dies 50 %, 2022 waren es noch 45 %. Gesparte Pendelzeit und ungestörtes Arbeiten sind Vorteile des Homeoffice, während die schlechtere ergonomische Ausstattung und die stärkere soziale Isolation Nachteile bedeuten. Für Personen ohne Führungsfunktion oder mit mehr Ressourcen als Belastungen geht eine Zunahme des Homeoffice-Anteils mit einer Reduktion von gesundheitsbedingten Produktivitätsverlusten einher.
Im Auftrag des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes hat zudem Sotomo die Haltung der Arbeitnehmenden in der Schweiz zur Flexibilität in der Arbeitswelt untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass viele sich mehr Flexibilität wünschen. Mehr als die Hälfte der Beschäftigten, deren Beruf flexible Arbeitszeiten grundsätzlich zulässt, wünscht sich flexiblere Arbeitszeitmodelle als die Gleitzeit. Momentan arbeitet nur ein Drittel in so einem flexiblen Modell. Die Studie beschäftigt sich ebenfalls mit den Auswirkungen von Flexibilität: Personen mit flexiblen Arbeitszeiten erleben zwar häufiger eine Vermischung von Arbeit und Freizeit als jene mit festen Arbeitszeiten. Es nimmt jedoch nur ein kleiner Teil von ihnen diese Vermischung als belastend wahr. Insgesamt berichten Menschen mit flexiblen Arbeitszeiten sogar seltener von Belastungen durch die Vermischung als Personen mit festen Arbeitszeiten.
Wie können Mitarbeitende selbst dazu beitragen, ihren Stress zu bewältigen?
Es gibt schweizweit ein breites Angebot an Kursen, in welchen Techniken und Strategien zur besseren Stressbewältigung vermittelt werden. Falls die Belastungen vor allem bei der Arbeit zu finden sind, empfiehlt es sich, mit Vorgesetzten und Arbeitskolleg*innen das Gespräch zu suchen. Falls sich dies schwierig gestaltet, können das Personalmanagement (HR) oder die Personalkommission ebenfalls Anlaufstellen sein.
Weiterführende Informationen:
Stress und psychische Gesundheit bei Psy-Gesundheit.ch
10 Schritte für deine psychische Gesundheit, praktische Alltagstipps
Wie steht die Schweiz im internationalen Vergleich da?
Das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO hat auf Basis der europäischen Telefonerhebung über die Arbeitsbedingungen 2021 die Daten für die Schweiz ausgewertet und mit den europäischen Ergebnissen verglichen:
Inwiefern hat die COVID-19-Pandemie die Stressbelastung verändert, und wie nachhaltig sind diese Effekte?
Eine Längsschnittstudie im Auftrag von Gesundheitsförderung Schweiz untersuchte, wie sich die Covid-19-Pandemie auf Belastungen, Ressourcen, Wohlbefinden und Produktivität von Erwerbstätigen ausgewirkt hat. Die Befragung erfolgte zu drei Zeitpunkten (2020, 2021 und 2022).
Zentrale Ergebnisse:
- Das Verhältnis von Belastungen und Ressourcen, Wohlbefinden und Produktivität blieb insgesamt stabil.
- Positive Entwicklungen aus dem Jahr 2021 waren 2022 nicht mehr durchgängig sichtbar.
- Männer und ältere Erwerbstätige berichteten von etwas positiveren Entwicklungen als Frauen und jüngere Personen.
- Ein günstiges Verhältnis von Ressourcen und Belastungen erwies sich als entscheidender Schutzfaktor für Wohlbefinden und Produktivität.
- Der Anteil an Homeoffice nahm 2021 stark zu und ging 2022 leicht zurück.
- Homeoffice bot Vorteile wie weniger Pendelzeit und ungestörtes Arbeiten, führte jedoch auch zu sozialer Isolation und schlechterer ergonomischer Ausstattung.
- Für belastete Personen wirkte ein plötzlicher Wechsel ins Homeoffice als zusätzlicher Stressfaktor, während er für ressourcenreiche Personen entlastend war.
Mehr Informationen zu Arbeitsbedingungen, Wohlbefinden und Produktivität bei Erwerbstätigen in der Schweiz während der Covid-19-Pandemie finden Sie in diesem Faktenblatt.